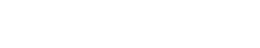Technischer Tipp zur Probenvorbereitung
Niveau: Grundlagen
Methoden zur Probenvorbehandlung von bioanalytischen Proben
Tipps in anderen Sprachen
Durch ihre besondere Beschaffenheit benötigen bioanalytische Proben oftmals einen Vorbehandlungsschritt vor der weiteren Aufreinigung mittels Festphasenextraktion (SPE). Jede Probenmatrix besitzt ihre eigenen Herausforderungen, wie z.B. die Abtrennung von Proteinen aus Plasma und Serum, das Aufbrechen von roten Blutkörperchen in Vollblut, die Hydrolyse von glucuronidierten Analyten in Urin und die Homogenisierung von Gewebeproben. Diese technische Mitteilung behandelt gängige Vorbehandlungsmethoden für bioanalytische Proben.
Plasma/Serum
Die Methode zur Vorbehandlung von Plasma und Serum ist abhängig vom Analyten. Falls der Zielanalyt eine Säure ist, kann 2 % Phosphorsäure verwendet werden (20 µl 85 % H3PO4 zu 1 ml Plasma oder Serum), um die Substanz-Protein-Wechselwirkungen zu unterbrechen. Falls der Zielanalyt basisch ist, kann 0,1 N Natriumhydroxid-Lösung eingesetzt werden, um die Substanz-Protein-Wechselwirkungen aufzuheben. Nach der Zugabe von Säure oder Base sollte die Probe mit einem Vortexer für 20-30 Sekunden geschüttelt und danach zentrifugiert werden. Der Überstand kann nun der weiteren Analyse unterzogen werden.
Vollblut
Es sind einige Strategien zur Vorbehandlung von Vollblutproben verfügbar. Befindet sich der Zielanalyt innerhalb der roten Blutkörperchen, ist ein Hämolyse-Schritt notwendig.
• Hämolyse: Zu 200 µl Vollblut (versetzt mit Analyt und internem Standard) in einem 1,2 ml Zentrifugenröhrchen werden 400 µl einer wässrigen Lösung mit 2 % Zinksulfat und 80 % Methanol zugegeben. Danach wird mit einem Vortexer für 10-20 Sekunden geschüttelt und die Probe bei 14.000 rpm für 10 Minuten zentrifugiert.
Der Überstand wird für die weitere Analyse abgenommen. Herstellung der wässrigen Zinksulfat/Methanol-Lösung: In einen 100 ml- Messkolben werden 20 ml Wasser und 3,6 g ZnSO4 x 7H2O gegeben. Nachdem die Lösung aufgeklart ist und alle Salzkristalle aufgelöst sind, werden 100% Methanol zugegeben. Die Lösung lässt sich gekühlt bei 2-8 °C für 7 Tage aufbewahren.
• Osmotischer Zerfall: Zu 1 ml Vollblut werden interner Standard und 4 ml destilliertes Wasser gegeben. Nach Mischen und Vortexen lässt man für 5 Minuten stehen. Es wird bei 670 g für 10 Minuten zentrifugiert und das Pellet verworfen. Der pH-Wert des Überstandes wird entsprechend der Zugabe einer Pufferlösung eingestellt.
• Ultraschallbehandlung: 1 ml Vollblut wird für 15 Minuten bei Raumtemperatur im Ultraschallbad behandelt. Danach werden 3-6 ml eines geeigneten pH-Puffers (wie z.B. Kaliumphosphat-Puffer) zugegeben. Nach Mischen und Vortexen lässt man für 5 Minuten stehen. Es wird bei 670 g für 15 Minuten zentrifugiert und der Überstand weiter analysiert.
Hinweis: Ein Vergleich obiger Vorbehandlungstechniken für Vollblut wurde für saure, basische und neutrale Verbindungen durchgeführt. Im Allgemeinen waren die Wiederfindungen am höchsten, wenn die Vollblutprobe mit Pufferlösung verdünnt und einer physikalischen Denaturierung (Ultraschallbehandlung) unterzogen wurde, statt chemische Mittel einzusetzen. In der Tat zerlegt die Ultraschallbehandlung die Zellmembranen derart, dass kein Verstopfen beobachtet wurde, wenn die oben aufgeführte Prozedur durchgeführt wurde. 1
Speichel
Für orale Flüssigkeiten ist keine Hydrolyse erforderlich und das allgemeine Protokoll, das für die Vorbehandlung von Plasma/Serum-Proben verwendet wird, könnte hierbei auch eingesetzt werden.
Urin
Im Falle von konjugierten Formen der Analyten (sulfatierte oder glucuronidierte Form) ist eine enzymatische Hydrolyse notwendig. Diese erfordert einen spezifischen Bereich des pH-Werts (pH 4-5) und der Temperatur. Eine saure oder basische Hydrolyse kann in Abhängigkeit der Substanzstabilität ebenfalls durchgeführt werden.
1. Enzymatische Hydrolyse: Zu 500 µl Probe (versetzt mit Analyt und internem Standard) werden 100 µl saurer Puffer (s. unten) und 20 µl Beta-Glucuronidase zugegeben. Das Gemisch wird für 5-6 Sekunden mit einem Vortexer geschüttelt und für 30 Minuten in einem Wasserbad bei 63 °C erwärmt. Danach wird die Probe in eine 96-Well Sammelplatte oder in ein Autosampler-Vial überführt, abgedichtet und für 10 Minuten bei 2000 rpm zentrifugiert. Herstellung des sauren Puffers (1 M Acetat-Puffer, pH 4.0): Man löst 3.0 g Eisessig und 4,1 g Natriumacetat in einem 1-L-Messkolben.
2. Basische Hydrolyse: Zu 1 ml Urin (versetzt mit Analyt und internem Standard) werden 100 µl 10 N KOH-Lösung gegeben. Es wird vermischt, mit einem Vortexer geschüttelt und für 20 Minuten bei 60 °C hydrolysiert. Nach Abkühlen wird pH 3,5-4 eingestellt (durch Zugabe von 200 µl Eisessig).
3. Saure Hydrolyse: Zu 1 ml Urin werden 0,25 ml halbkonz. HCl-Lösung in ein verschraubbares Probengläschen gegeben. Das Gläschen wird locker verschraubt und in einem siedenden Wasserbad für 60 Minuten erhitzt. Danach wird der pH auf einen Wert von 7 (bzw. wie entsprechend erforderlich) mit 1 N NaOH-Lösung eingestellt.
Gewebe
Abhängig von der Löslichkeit des Analyten wird die Probe mit organischem oder wässrigem Lösungsmittel homogenisiert. Man lässt die festen Bestandteile absetzen, dekantiert, zentrifugiert oder filtriert den Überstand. Mit Gewebeproben kann man direkt eine sog. Matrix Solid Phase Dispersion (MSPD) durchführen.
Literaturverzeichnis: 1. Chen et al., J. Anal. Toxicol. 1992, v18, Seiten 352-355